- Start
- Über uns
- Kontakt
- Ist mir egal. Ich laß das jetzt so.
- Ein Abendkleid für meinen Sohn/Leseprobe
- Kinderbuch Englisch "Turtles"/Leseprobe
- "Smart" und andere kurze Texte
- Entschuldigung, aber ich hab da gerade 'ne neue App ...
- Wo wir gerade bei Fotos sind ...
- Familienalbum - ganz privat
- Noch ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit
- Das ist ja furchtbar. Ich kann so nicht arbeiten!
- Weitere Kurztexte
- Für immer wir ... na so ein Kitsch!
- Unser Facebook-Projekt ... aber auch Nicht-Facebooker sind eingeladen!
- Fort- und Weiterbildung
- ES IST DA!!!!
- Noch mehr kurze Texte!
- Kritik
- Messen
- Roman Nr. 2: "Ein Abendkleid für meinen Sohn"
- Ein wenig Horror: Bosheit Für Einsteiger
- Schon wieder: Kurze Texte!
- Geburtstagswünsche
- Schnipsel
- Support „Dancing Stars“ ( ORF 4-6/17 )
- Filmkritiken
- Restaurants
- Biografisches
- Kurze Texte - das hört ja gar nicht auf!
- PATIENTEN ....
- Lebensgeschichte - aber nur der jugendfreie Teil!
- Dein Beichtstuhl
- Herzensanliegen ...
- Autorentag
- Awards
- Ich les' ja nicht so gern Mystery. Du etwa?
- Kurztexte die Soundsovielte ...
- Hater! ( Zu Deutsch: Hasser. Ja, die gibts! )
- „Smarter“ und weitere Kurztexte
- Abschied
- Märchenhafte Tage 16.6./17.6.18
- Noch ein paar kurze Texte ( Wieviel GB hab ich eigentlich noch? )
- Der Chefarzt lässt grüßen!
- Das hört ja gut auf!!!
- Das Jahr geht zu Ende
- Wie man keinen Krimi schreibt ...
( Ein Ex-Facebook-Freund hat mich kürzlich gefragt, warum ich so viel uninteressanten Quatsch schreibe. Jan hatte damit ja nicht unrecht. Ich merke allerdings, dass es mir hilft.
Therapeutisches Schreiben, sozusagen. Ich habe gestern, veranlasst durch ein trauriges Telefonat, erstmals wieder meine Praxiszeit Revue passieren lassen. An Patienten gedacht, die ich
betreut habe. Von einigen würde ich gern erzählen - die Namen ändere ich natürlich.
Auch den von meinem rumänischen Freund .... )
Dan Georgescu
Es war mir klar, dass diese Nachricht mich irgendwann erreichen würde. Als das Telefon gestern Abend klingelte, hatte ich gleich dieses eigenartige Gefühl. Die Uhrzeit, der Wochentag ... Er
ist tot. Seine Frau, die mir die Neuigkeit mitteilt, hatte drei Jahre Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Sie klang gefasst. Sachlich. Seltsam kühl.
Er hatte geweint, als wir uns im Dezember 2015 zuletzt sahen. Er war auf mich zugegangen, hatte mich in den Arm genommen, und meine rechte Schulter nassgeweint. „Was soll ich jetzt machen“,
hatte mich Dan gefragt. Ich erinnere mich, dass ich verlegen auf seinen Rücken klopfte. „Na so'n Quatsch“, sagte ich. „Jeder kann das genauso gut wie ich. Du wirst den Unterschied gar nicht
merken.“ Das Aroma von Aramis Classic lag in der Luft.
So hatten wir schon einmal dagestanden ...
Ein rumänischer Patient wurde mir angekündigt. Und wie immer wunderte ich mich über die Kaskade von Vorurteilen, die sich in meinem Kopf in Bewegung setzte. Rumäne, ausgerechnet. Als Arzt
kämpft man diese natürlich tapfer nieder, aber als fehlbarer Mensch ...
Ich war überrascht, als Herr Georgescu mein Sprechzimmer betrat. Ein gut aussehender, gut gekleideter Herr in meinem Alter, höflich, der auf meine Einladung hin Platz nahm - auf der anderen
Seite meines gläsernen Schreibtisches. Statt einer Antwort auf meine Frage, wie ich ihm helfen könnte, zog er einen Zettel aus einer Innentasche seines Jacketts. Ein Laborbefund. Mein Blick
fällt sofort auf eine unvorstellbar hohe Zahl. 1273 ng/ml. Um Gotteswillen! Sein PSA ist 1273! Der Normwert für diesen Tumormarker des Prostatakrebses liegt zwischen 0,00 und 4, ab 2,5 wird
man nervös.
Die Untersuchung bestätigte meinen schlimmsten Verdacht. Er sah mich hoffnungsvoll an. „Da habe wir ja einen ziemlichen Berg Arbeit vor uns“, hörte ich mich sagen. Er begriff. Tränen
liefen über sein Gesicht. Er zitterte vor Angst. Ich nahm ihn in den Arm. „Komm, Dan. Ran an den Feind.“ Ein Duft nach Aramis Classic umgab ihn.
Die Tabletten kosteten knapp € 5000.- für einen Monat. Er war in Rumänien versichert, keiner wußte, ob die ein so teures Arzneimittel übernehmen würden. Nach vielen Telefonaten half die Firma
mit zwei ‚Mustern‘ für die ersten zwei Monate. Ein kleines Wunder geschah. Nach einer Woche hatte der Wert sich halbiert, und sank unaufhaltsam. Von 1273 auf 0,6 ng/ml. Und ich mutierte in
seinen Augen zu einer Art Wunderheiler.
„Du musst es Deiner Frau sagen.“
„Das kann ich nicht. Die macht sich Sorgen.“
„Macht nichts. Sie muss es wissen!“
„Nein.“
„Und wenn wir gemeinsam ...?“
„Nein.“
„Höre doch auf mich.“
„Nein.“
Wir waren nicht nur ernst. Unser Verhältnis war freundschaftlich-vertraut. Wir alberten auch herum. „Ich hab ein schönes Haus in den Karpaten. Fast ein Schloss. Du musst unbedingt kommen. Ist
großartig, da!“ Ich lachte. „Kommt nicht in Frage, Graf Dracula!“ Ab da hieß er so bei mir, Graf Dracula. Er brachte Fotos mit. Atemberaubend. Mit und ohne Vampire.
Ja, und dann kam der Abschied. Dezember 2015 ...
Wir telefonierten regelmäßig. Wie alte Freunde. „Du musst bei mir bleiben“, hatte er gefordert, bei seinem letzten Termin. Er war ein wunderbarer, liebevoller, warmherziger Mann. Vor einem
Monat war seine Nummer nicht mehr zu erreichen. Ich war mit Anrufen dran, und ein Automat schlug vor, es später noch einmal zu versuchen. Das tat ich eine Woche später, mit dem gleichen
Ergebnis. Erst hatte ich mir nichts dabei gedacht, ein neuer Vertrag, vielleicht, ein anderer Anbieter ... Dan würde sich schon melden. Bestimmt.
Seine Erkrankung hatte ihn eingeholt. Ja, sie hatte es geahnt. Schon wegen der Medikamente, die er aus Deutschland holte. Sie kannte seine Verstecke. Ihr Hausarzt hatte ihr erklärt, wofür die
Tabletten sind. Aber sie hatte nichts gesagt, um ihn nicht zu belasten. „Er hat gedacht, dass ich es nicht aushalte“, sagte sie.
Ich denke an Dich, Dan. An meinen Grafen Dracula. Sein Schloss in den Karpaten. Und den Duft von Aramis.
( Ja, ich weiß. Viele Leute glauben, dass ich soooo ein netter Arzt war, weil ich so lieb und nett mit meinen Patienten umging. Ich kann Euch allen sagen: Das war purer Egoismus! Ist es
denn nicht viel schöner für alle Beteiligten, wenn man sich mag? Befreundet ist? Sich lieb hat? Die Zusammenarbeit, ohne die es in der Medizin nicht geht, zwischen Patient und Arzt
funktioniert auf diese Weise viel besser. Und ich dachte immer, wozu soll ich mir das Leben unnötig erschweren?!
Der Hamburger, wenn er spricht, trennt gern s und p, und s und t. Er s-tolpert über'n s-pitzen S-tein. Bitte beachtet das, wenn Ihr den folgenden Text lest ... )
Käthe Schumann
Käthe kam immer Mittwochs. Immer den letzten Mittwoch im Monat. Kurz vor 12. Ohne Termin. Bevor die Helferin die Praxis abschließen konnte, schlüpfte sie durch den Spalt der noch offenen
Tür.
Sie war 79, rotwangig und gesund. Sie misstraute Autos, Bussen und Bahnen, weswegen sie jeden Tag bei Wind und Wetter von Mümmelmannsberg nach Billstedt marschierte. Und wieder retour. Und
wenn ich sage, „marschierte“, dann meine ich das so. In späteren Jahren stürzte sie immer wieder, brach sich den linken Arm, und hatte ein blaues Auge. Ich habe mich Dreiviertel totgelacht.
„Käthe, wie sieht der andere aus?“ Sie verstand nicht. „Na! Zu einer Schlägerei gehören doch immer zwei!“
Käthe sah mich empört an. „Dummer Junge! Ich bin doch ges-türzt! Am Havighorster Redder! S-tell Dir das bloß mal vor!“
„Käthe, was rennst Du denn auch immer durch die Gegend? In Deinem Alter! Das kann doch nicht gut sein!“
„Jung, nun lass mich mal. Du weißt, dass ich in diese Höllenmaschinen nicht eins-teige!“
Nein, das tat sie nicht. Einige Male sah ich sie, hielt an, kurbelte die Scheibe herunter und rief, „Deern, komm, steig ein!“
„Da sei Gott vor“, antwortete sie. „Ich lauf lieber!“
Käthe war kerngesund. Sie kam eigentlich nur, um sich das bestätigen zu lassen. Aus ihrer Handtasche produzierte sie zwei Glasgefäße: Ein ehemaliges Marmeladenglas mit Urin, und eine
Piccolo-Flasche ‚Faber‘-Sekt. „Käthe, und wenn ich das nun verwechsele?“
„Dann zieh ich Dich an den Ohren! Gib mir mal 'n Kuss!“
„Käthe, Du vergissest Dich!“
„S-tell' Dich nicht so an. Hierhin!“
Grinsend drehte sie den Kopf zur Seite und präsentierte mir ihre rechte Wange. Ich drückte ihr einen auf.
„Hmmm, das muss ich sagen, Dein Bart kratzt besser als der von Dr. Jochum ( der Orthopäde im Haus )!“
„Käthe, ich fühl' mich benutzt!“
„Ach was! S-püle es mit dem Sekt 'runter!“
Der Sekt war ungenießbar. Ich wußte, dass sie eine winzige Rente bezog, und ich kam mir furchtbar vor, weil ich den Inhalt der Flasche nur fortgoss. Eines Tages machte ich einen Fehler. Die
kleine Zeremonie mit den beiden Gefäßen fand, wie immer, statt. „Mensch Käthe, nun hör bloß auf, mich hier immer abzufüllen!“
In ihren Augen sah ich plötzlich Enttäuschung, Verletzung, Trauer. „Ist nicht gut genug, für Dich, oder?“
Ich brauchte eine Viertelsekunde, um zu begreifen. „Du alte Zicke“, äußerte ich charmant. „Red' nicht so'n Mist. Ich will nur nicht, dass Du Deine Rente hier für mich auf den Kopf haust!“
Blitzartig verzog sich die Trauer aus ihrem Gesicht. Spitzbübisch grinsend entgegnete sie, „Ach, ich kenn' Euch! Ärzte saufen alle! S-timmt doch, oder?“
Wir feierten ihren 80. in der Praxis. Mit ‚Faber‘-Sekt, und von mir höchstselbst gebackenem Käsekuchen ( „Was Du alles kannst, min Dschung'!“ ).
Sie war kerngesund. Auf den Überweisungen stand immer „Zuweisung auf Wunsch der Patientin“. Sie hätte mich nicht gebraucht. Zumindest nicht als Urologen.
Eines letzten Mittwochs im Monat kam sie nicht. Ich hatte Samira gebeten, nachzusehen. Vor der Tür. Sie war nicht da. Ihr Hausarzt, den ich am Folgetag anrief, erzählte, dass sie erneut
schwer gestürzt sei, und in der Klinik einen Schlaganfall erlitten hatte.
Ich besuchte sie. Sie war nicht mehr ansprechbar. „Blöde Kuh“, habe ich zu ihr gesagt. „Was rennst Du auch immer durch die Gegend, in Deinem Alter?“
Und dann habe ich ihr einen Abschiedskuss gegeben.
Und extra etwas mit meinem Bart gekratzt.

( Ich habe es immer besonders schrecklich gefunden, dass junge Menschen allein aufgrund ihres Wohnbezirks gewissen Vorurteilen ausgesetzt sind. Mümmelmannsberg? Aha. Drogen,
Beschaffungskriminalität, maximal Hauptschule, bestenfalls, aber selten, mittlere Reife. Ich habe immer gern mit den „Kids“ über Träume gesprochen, Zukunft, Hoffnung. Und sie daran erinnert,
was alles in ihnen steckt. Und ich hatte das Glück, so viele brillante, witzige, intelligente Mädchen und Jungen kennenlernen zu dürfen. Und manchmal erlaubten sie mir sogar, etwas zu bewegen
... )
Hinnerk Berts
Mit 17 zum Urologen? Ja, manchmal ist das nötig. Man kann sich ja so viel häßliche Erkrankungen einfangen, wenn man auf Kondome verzichtet. Und dann braucht man ganz viel Tabletten und
gelegentlich auch Spritzen, um den Mist wieder loszuwerden.
Ich kannte Hinnerks Familie schon länger. Den grobschlächtigen, meist alkoholisierten Vater, die angstvoll-zarte, unter Depressionen leidende Mutter. Nun aber saß er vor mir.
Ein wacher, intelligenter Junge, der sich gut ausdrücken und sogar Humor entwickeln konnte. Ich fand es fast schade, dass die Infektion so schnell zu beheben war, aber so ist das halt in
diesem Beruf: Die Kinder werden erwachsen und gehen aus dem Haus, um ihr eigenes Leben zu führen. Und das ist ja auch gut so. Wer will denn ständig die lieben Kleinen um sich haben, morgens,
wenn man zur Arbeit geht, auf der Treppe ...
... auf der Treppe saß Hinnerk. Ungefähr 4 Wochen nach unserem letzten Termin. Morgens um 6:30 Uhr. Meiner üblichen Zeit, das Gebäude zu betreten. Er sah fürchterlich aus. Hatte geweint.
Nicht geschlafen. Sein Vater hatte im Suff versucht, die Mutter zu schlagen, sei gestolpert und auf den Glastisch geschlagen. Er glaubte, er sei tot.
Das, was folgte, kennen wir alle aus den kriminalistischen Vorabendserien. Wichtig ist, dass meine Totenbescheinigung, in der ich einen Unfall mit der Folge eines Genickbruchs unter
Alkoholeinfluss attestierte, amtlich bestätigt wurde. Und wichtig war, dass Hinnerk ein paar Tage später in die Praxis kam.
„Du siehst Scheiße aus!“
„Ich fühle mich auch Scheiße.“
„Halte mich nicht für herzlos, aber ich glaube, dass einige Eurer Probleme gelöst sind, meinst Du nicht?“
„Ja, aber Mama ist komplett abgerutscht. Ich trau mich nicht, sie allein zu lassen, mit ihrer Depression. Ich glaube, ich schmeiß' die Schule. Dann kann ich mich um sie kümmern!“
Ich hielt die Luft an.
„Du, das ist ja wirklich eine klasse Idee! Damit aus Dir auch ganz bestimmt nichts wird! Großartig! Da hat sie dann ja wenigstens noch einen Grund zur Verzweiflung!“
„Ich kann mich aber auch gar nicht richtig auf Schule konzentrieren!“
„Wann machst Du Dein Abi?“
„In drei Monaten. Etwas mehr.“
Ein paar Telefonate folgten. Mit der Mutter. Der Psychiaterin. Dann bestellte ich Hinnerk wieder ein.
„Wir machen es so: Du kommst jeden Tag nach der Sprechstunde mit Deinen Schulsachen her. Ich kann Dir außer in Mathe überall helfen.“
So geschah es. Manchmal merkte ich, dass ich den Mund etwas zu voll genommen hatte. Aber dass, was er nicht konnte und ich nicht wußte, erarbeiteten wir uns gemeinsam. Und wenn jemand glaubt,
denken zu müssen, ach Gott, erst der anstrengende Arbeitstag, und dann noch Hausaufgaben, dem muss ich sagen: Es war wunderbar. Ein befriedigendes Vierteljahr. Und es hat mir unglaublich viel
Spaß gemacht.
Hinnerk legte ein glänzendes Abitur hin.
Ja, und plötzlich waren drei oder vier Jahre vergangen. Tagein, tagaus die liebe Arbeit. Alles in demselben Rhythmus. So auch an diesem Tag, an dem ich nach der Sprechstunde wie gewohnt
über den Parkplatz lief, um heimzufahren. Ein netter junger Mann, der mir in diesem sozial schwachen Bezirk sofort auffiel, weil er optisch nicht ins Bild passen wollte, steuerte auf
mich zu. Dunkler, perfekt sitzender Anzug, weißes Hemd, bunte Krawatte.
„Hallo Peik!“
„Hinnerk, bist Du das?“
Er lebte jetzt in Frankfurt am Main. Er hatte in Hamburg eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann angestrebt. Sein Ausbilder erkannte sein Potential und schickte ihn ins Mutterhaus nach
Frankfurt. Dort drängte man ihn zum Studium, ihm seinen Arbeitsplatz freihaltend. ( Inzwischen liegt seine Hauptbeschäftigung in der Betreuung der Depandancen der Versicherung im asiatischen
Raum. )
„ ... und verheiratet bin ich auch. Und weißt Du, wo ich meine Frau kennengelernt habe?“
„Na?“
„Bei Dir im Wartezimmer!“
Ich sah Hinnerk und seine Frau von da an regelmäßig einmal im Jahr, zur Früherkennungsuntersuchung. So lange, bis ich den Laden verkaufte. Sie wohnten in einem schönen Haus in einem der
eleganten Vororte von Hamburg, das auch Platz für ein Kind bot ...
Eine ganz besondere Freude machte er mir, als er mit einer laminierten Kopie seines Diploms hereinkam. Er hatte sie mit einer riesigen Schleife umwunden. Er umarmte mich, und drückte mir das
Angebinde in die Hand.
„Da. Das ist auch Dein Diplom. Danke."

( Altersdiskriminierung ist ein Boomerang. Damit habe ich, ehrlich, auch nicht gerechnet. Man glaubt ja nicht, dass man alt wird. Älter - ja, schon. Das möchte man ja auch. Aber so richtig
alt? Faltig? Unansehnlich? Körperlich und irgendwann auch geistig beeinträchtigt? Nein danke.
Kennt Ihr alte Menschen? Geht es Euch so wie mir? Vergeßt Ihr, dass sie mal jung waren, und schön, und voller Hoffnung? Hübsche junge Mädchen? Attraktive, durchtrainierte Jungs?
Inzwischen bin ich selbst alt. Naja, älter. So alt noch nicht. Ich bin noch nicht abhängig von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft anderer. Angewiesen auf fremde Hilfe. Unselbständig.
Nein, noch nicht ... )
Margaretha Pfrang
Ich habe nie mehr Falten in einem einzigen Gesicht gesehen. Frau Pfrang wurde mir vom Hausarzt als sehr schwierige Patientin angekündigt, die sich mit dem urologischen Fachkollegen aus
Billstedt bereits völlig überworfen hatte. Eine schlanke, hochaufgerichtete alte Dame von 82 Jahren saß diszipliniert vor mir. Ihr Rücken berührte die Stuhllehne nicht. Ihre Lippen hatte sie
aufeinandergepresst, so dass diese wie ein dünner Strich über ihrem Kinn aussahen.
Sie litt unter wiederkehrenden Infektionen und unwillkürlichem Urinverlust. Der vorbehandelnde Kollege hatte gute Arbeit geleistet. Perfekte Diagnostik, einwandfreie Medikation. „Ich würde
gern Ihr reiches Innenleben kennenlernen, Frau Pfrang. Begleiten Sie mich einmal in den Ultraschall-Raum?“
„Wie sie wünschen.“
Ja, der Befund entsprach dem des Kollegen völlig. Was wollte sie eigentlich von mir?
„Was kann ich denn nun für Sie tun, Frau Pfrang? Der Kollege hat alles richtig gemacht mit seiner Behandlung! Es müsste Ihnen deutlich besser gehen!“
„Es geht mir nicht besser.“
„Nun, von Fall zu Fall kann es vorkommen, dass Medikamente nicht so wirken, wie man es erwartet, oder Nebenwirkungen haben, mit denen man nicht gerechnet hat, aber ...“
„Es geht mir nicht besser, weil ich das Zeugs nicht genommen habe.“
Ach Du meine Fresse! So eine! Schrecklich! Will ich mir mit sowas den Tag verderben?
„Liebe Frau Pfrang, es ehrt mich sehr, dass Sie mir Wunderheil-Kräfte zutrauen, aber da muss ich Sie enttäuschen. Sie gehen jetzt bitte heim, nehmen die Tabletten, und in 4 Wochen kommen Sie
zur Kontrolle. Oder, noch besser, Sie gehen zu dem Kollegen, der Ihnen die Tabletten verordnet hat. Guten Tag!“
„Das ist alles? Mehr können Sie nicht?“, schallte es hinter mir her. Die Tür fiel ins Schloss. Grauenhafte Zicke!
Vier Wochen später. Ich sage zu den Mitarbeitern bei der Tagesplanung, „hier, den Termin um 14 Uhr, Pfrang, Margaretha, könnt ihr neu vergeben. Die kommt garantiert nicht.“
Sie kam. Sie saß mir gegenüber, stocksteif, kerzengerade. Ihr Rücken berührte die Stuhllehne nicht. Was ich für sie tun könnte, fragte ich gereizt.
„Herr Doktor, das war nicht schön von Ihnen, neulich“, erklärte sie ganz ruhig. „Sie haben nicht einmal gefragt, warum ich die Tabletten nicht genommen habe!“
Das konnte ich nicht bestreiten. Wir verbrachten also den Termin damit, über Wirkungen und Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit ihren anderen Medikationen und Risiken zu besprechen.
„So. Jetzt nehme ich es auch.“
Es half ihr. Gut, sogar.
Von ihrer Nichte erfuhr ich eines Tages, dass sie ihre Wohnung hatte aufgeben und ins Pflegeheim ziehen müssen. Außerdem konnte sie nicht mehr zu mir kommen. Sie hatte um einen Besuch
gebeten. Also machte ich mich auf.
Als die Leiterin der Station hörte, wenn ich zu besuchen gedachte, schaute sie mich mitleidig an. „DAS ist Ihre Patientin? Sie Armer!“
Sie saß in Ihrem Sessel, als ich eintrat. Ihr Rücken berührte die Lehne nicht.
„Man wird so hässlich, im Alter“, sagte sie zu mir. „Sehen Sie meine Falten?“
Ich beeilte mich, irgendeine Nettigkeit zu stammeln. Und das war nicht unaufrichtig. Ganz ehrlich, die Falten störten überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich hätte bei einer Dame in den 80ern eher
ein glattgezogenes Botox-Gesicht als lächerlich empfunden.
„Dabei war ich mal ein so niedliches junges Mädchen! Haben Sie etwas Zeit? Darf ich Ihnen ein paar Fotos zeigen?“
Sie erhob sich, öffnete eine Schublade ihrer Kommode und zog eine Schachtel mit alten, vergilbten oder sepia-braunen Schwarz-Weiß-Fotos hervor. Schwarz-weiß-Fotos, die ein junges,
bildhübsches Mädchen zeigten, beim Ballett, in Tutu und Spitzenschuhen tanzend.
Sie hatte eine beispiellose Karriere vor sich gehabt, bis zu dem Tag, an dem Sie sich den Fuß brach, beim Sturz auf der Kellertreppe. Da war es dann aus.
Ich betrachtete die Abbildungen dieses feenhaften, ätherischen, zerbrechlichen Wesens. Diszipliniert. Kerzengerade. Was für ein zartes, glattes Gesicht. Und selbst beim Sitzen berührte ihr
Rücken die Stuhllehne nicht. Niemals.


( Auch ein Arzt hat menschliche Bedürfnisse. Ja, man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum, weil er ja ein Übermensch ist, etwas Besonderes. Mein Professor für Augenheilkunde im Klinikum
Westend sagte immer, „die Krone der Schöpfung“. Na schön. Aber auch so einer braucht mal Urlaub. Keine Patienten. Keine Verantwortung. Weg von menschlichem Leid, Elend und Not! Pure
Entspannung! Aufstehen, Frühstück, Pool oder Strand, Mittagessen, Kaffeetrinken, von den Strapazen etwas ausruhen, Duschen, und auf einen Absacker in eine nette Kneipe. 8 Tage lang.
Wunderbar! Was schert mich das Leid anderer Leute, sagt man in Hamburg, und vermutlich auch woanders .... )
Ulrich Frühling
Ein unglaublicher Mann. Er kam nicht einfach in mein Sprechzimmer. Er trat auf, wie ein Bühnenschauspieler. Ein Hingucker. Charmant, eloquent, witzig, und einfach schön. Strahlend. Ja, er
strahlte. Sogar mich an. Was war er von Beruf? Lehrer? Verschwendung.
„Aha! Da plant jemand seinen Urlaub!“
„Ja, genau! Weihnachten. Da fallen die wenigsten Arbeitstage aus!“
„Wo soll's denn hin ... ach, Gran Canaria, wie schön!“
„Ich bin nicht sicher. Ich war noch nie dort!“
„Ernsthaft? Ich bestimmt schon tausendmal. Ich kenne da jeden Kieselstein! Und jede schwule Kneipe!“
„Sie sind berentet! Sie haben doch Zeit! Wenn wir mit Ihrer Prostata fertig sind ... Koffer gepackt, und auf nach Fuhlsbüttel!“
An diesem Punkt bekam die glänzende, strahlende Fassade Risse. Und sie begann, zu bröckeln. Seine riesigen, braunen Augen schienen noch größer zu werden. Er blickte unsicher zu Boden, dann zu
mir.
„Wissen Sie, seit meiner Diagnose ... ich trau mich nicht mehr, allein.“
Er war in Hamburg in der Szene ein bekannter Mann gewesen, Aktivist, und hatte auch sonst nichts anbrennen lassen. Immer im - natürlich strahlenden - Mittelpunkt, bei jeder Veranstaltung, in
jeder Kneipe, Bar oder Disco. Dann war es still um ihn geworden. Verdammt still. Er verlor seinen Job, weil der Schulträger seinen Kontakt zu Minderjährigen nicht mehr billigen mochte. Mit
seinem Arzt in der HIV-Ambulanz hatte er die Frührente beantragt und zuerkannt bekommen.
„Ich hatte früher Freunde und Bekannte. Einige sind bereits gestorben, und die anderen kennen mich nicht mehr. Sie halten Abstand. Angst, sich anzustecken, Sie verstehen!"
„Was ist mit Ihren Eltern?“
Er lachte bitter.
„Die haben es sowieso als Schande aufgefasst, mit einem schwulen Sohn geschlagen zu sein. Und im letzten Telefonat mit meiner Mutter - vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich - hat sie mir klar
gemacht, dass ich zu Hause nicht mehr willkommen bin, und falls ich AIDS bekäme, sie sich nicht um mich kümmern würde.“
Er wischte die Trauer in seiner Stimme mit einer Handbewegung fort. Er fasste sich, lachte, zwinkerte mir zu und erkundigte sich wie ein Reporter:
„Und wie geht es Ihnen so?“
Es war recht schwierig, ihn wieder hinzubekommen, zumal da sich, wegen der Immunschwäche, natürlich auch noch ein Abszess entwickelte, der aber gut zu punktieren war. Im Anschluss an die
Punktion meinte er trocken: „Sie haben mehr an meiner Prostata herumgefummelt als jeder andere. Findest Du nicht ...? - ich heiße Uli!“
Und er streckte mir seine Hand entgegen.
„Und? Schon gebucht?“
Es war die letzte Kontrolle. Alles war gut abgeheilt, die Tabletten konnten abgesetzt werden.
„Heute ist der große Tag. Ich geh nachher gleich 'runter!“
Er seufzte.
„Ich beneide Dich! Aber Du hast ja gesehen ... wenn mir sowas auf der Insel passiert, bin ich aufgeschmissen. Ich trau mich einfach nicht.“
„Und wenn Du unter ärztlicher Aufsicht reistest?“
„Du meinst ...?“
„Ja.“
„Das würdest Du für mich tun?“
„Red' keinen Quatsch. ICH mache Urlaub, und Du bist zufällig auch da. Setz' Dich ins Wartezimmer, wir gehen nachher zusammen buchen.“
Unser gemeinsamer Urlaub verlief ohne Zwischenfälle. Wir hatten einen Bungalow in einer Anlage genommen. Er belegte die untere Etage, weil ihm die Treppe zu schaffen machte. Ohne
Zwischenfälle? Doch. Beim Abflug. Wir hatten schon das Gepäck eingecheckt und die Bordkarten erhalten. Und plötzlich war Uli verschwunden. Auch die Lautsprecherdurchsagen, er möge sich zum
Gate begeben, fruchteten nicht. Ich war ja verantwortlich und rannte durch alle Hallen des Gebäudes, dann sogar heraus. Ich fand ihn, auf einem kleinen, grasbedeckten Erdhügel sitzend, und
vor sich hinstarrend.
„Mensch Uli, ich such Dich überall! Du bist schon zweimal ausgerufen worden! Komm, die Maschine wartet nicht! Was machst Du denn hier?"
Er blickte auf und sah mich an, aber ... kennen Sie das? Jemand schaut Sie an, und auch wieder nicht. Er starrt in Ihre Richtung, aber irgendwie ... durch sie hindurch, oder an Ihnen vorbei.
„Ich habe nur Abschied genommen“, antwortete er.
Uli hatte in seiner Wohnung, in der ich ihn jede Woche besuchte, weil er sie nicht mehr verlassen konnte, unendlich viel Kunstgegenstände, wertvolles Porzellan, Kupferstiche, Teppiche,
Silberbesteck. Kaum, dass er, mit 38, gestorben war, so erzählte mir der Junge vom ambulanten Pflegedienst, war seine Mutter auf dem Plan erschienen, und hatte in einer Nacht- und Nebelaktion
alles von Wert in Ihren spießigen kleinen Golf Variant geräumt.
Ich habe ein Andenken an diesen Urlaub. Ich hatte ein paar Videoaufnahmen gemacht, und ihm das Video als Andenken geschenkt. Dieses hab ich kürzlich auf DVD kopiert. Meine Lieblingsaufnahme
von ihm ist in Palmitos Parque entstanden. Uli, glücklich, überrascht, strahlend, mit einem Ara auf der Schulter, der sich voll Vertrauen und ohne Angst, sich anzustecken, von ihm mit
Weintrauben und Nüssen füttern läßt.


( Es gibt nicht nur diese freundlichen, aalglatten, geradlinigen Fälle, die gut und regelrecht verlaufen. Wo Menschen aufeinanderprallen, ist immer Raum für Missverständnisse, Streit,
Ärger gegeben. Ich bin bis heute nicht sicher, ob ich mich hier richtig verhalten habe, und stelle das gern zur Diskussion. Ich habe mich an ein oberstes Prinzip gehalten. Ohne berechnend zu
sein - Berechnung stellte sich auch bei diesem Patienten als Fehler heraus. Ich habe nur mit Menschen gearbeitet, zu denen ich irgendeinen Draht hatte. Patienten haben das Recht, sich ‚ihren‘
Arzt auszusuchen. Weniger ist bekannt, dass auch der Arzt sich ‚seine‘ Patienten aussuchen darf. Notfälle sind da natürlich ausgenommen. )
Wenn ein 26jähriger einem Urologen gegenüber sitzt und darüber klagt, dass einer seiner Hoden verhärtet und geschwollen ist, gefriert einem nahezu automatisch das Blut in den Adern - wenn man
zufällig dieser Urologe ist. Allzu oft nur muss man die Diagnose ‚Hodenkrebs‘ bestätigen, und da die Patienten sehr jung und im Krankwerden ungeübt sind, muss man mit erheblichen Reaktionen
auf das Unfassbare rechnen.
Steffen machte da keine Ausnahme. Er war Mathematiker und hatte als solcher gelernt, eins und eins zusammenzuzählen. Die Diagnose war schon im Ultraschall völlig eindeutig. Nach
kompletter Diagnostik mit Tumormarkern und Kernspin-Computertomografie schickte ich ihn zu dem Besten, den ich kannte, Klaus-Peter Dieckmann im Klinikum Steglitz der FU Berlin. Da der Tumor
weiter fortgeschritten war, folgte noch eine Chemotherapie. Es handelte sich um einen komplizierten Mischtumor, besonders schwierig war der Anteil der aggressiven Zellen der embryonalen
Karzinoms.
Nach einem Jahr erlitt Steffen einen Rückfall. Es wurden ihm die Lymphknoten im Bauchraum entfernt, ein Teil der rechten Lunge, und erneut erfolgte eine Chemotherapie.
Ja, und dann begann eine schöne, heitere Zeit. Alles verlief perfekt. Wir wurden gute Freunde, gingen oft in der Mittagspause auf einen Kaffee oder Eisbecher. Wenn ich ihn aufrief, tat ich
das meist mit den Worten, „Der junge Simulant bitte in die 1 zur Blutentnahme!“, worüber wir uns beide kaputtlachten. Seine Eltern kamen als Patienten zu mir. Alles lief wie bei einer gut
geölten Rechenmaschine.
Und dann, nach 10 Jahren, stieg plötzlich das ß-HCG, einer der Tumormarker. Der Krebs war zum zweiten Mal zurückgekommen. Steffen konnte sich ausrechnen, in welcher Gefahr er schwebte. Ich
schickte ihn in die Charité zur Hochdosis-Chemotherapie. Einen Monat hofften wir. Umsonst. Ich rief so ziemlich jede Onkologie in der Republik an. Frau Huland im UK Eppendorf bot einen
Versuch mit Interleukin 2 an.
Das Telefonat mit der DAK Bergedorf war erfreulich. Und trotzdem erhielt Steffen einen Brief, in dem die Kasse eine Kostenübernahme ablehnte. Die Sachbearbeiterin war für mich nicht mehr zu
erreichen. Erkrankt, zu Tisch, freier Tag, Urlaub. Sie rief auch nicht, wie zugesagt, zurück.
Die Therapie hätte 3000 DM/Woche gekostet. Mein erster Vorschlag ging dahin, Öffentlichkeit herzustellen. RTL, SAT 1, BILD kämpft für Sie. Das, meinte Steffen, sei nicht sein Niveau. Er habe
bereits den Rechtsweg beschritten. Er rechne mit einer baldigen Zusage der DAK. Na gut.
Heimlich rief ich die Mutter an. Ob sie ggf. - bis zum Urteil des Gerichts - die Kosten übernehmen könnte. „Ach wissen Sie“, meinte die Mutter, „ich habe das schon mit meinem Mann besprochen
und durchgerechnet. Man weiß ja nicht, ob das wirklich klappt. Und wenn nicht, sind unsere beiden Eigentumswohnungen gefährdet ...“
Tja ... sehr schnell war der Zustand erreicht, dass er seine Eigentumswohnung nicht mehr verlassen konnte. Damit hatte ich schon gerechnet, und hatte Schwester Sabine von der Sozialstation
Mümmelmannsberg gebeten, die Pflege zu übernehmen. Ich wollte ihn perfekt versorgt wissen. Sabine war nicht nur eine wunderbare, großartige Krankenschwester, sondern ein warmherziger,
freundlicher Mensch. Als ich ihr die Adresse sagte, reagierte sie traurig. „Er wohnt in Bergedorf. Wir dürfen nur Patienten in Billstedt versorgen. Aber wissen Sie was? Das liegt auf meinem
Heimweg. Ich gehe sozusagen privat bei ihm vorbei, wenn's recht ist.“
Steffen starb nach 2 Monaten, ohne sein 37. Lebensjahr erreicht zu haben. Dies erfuhr ich nicht durch seine Eltern. Kein Anruf, keine Karte. Schwester Sabine rief mich an.
14 Tage später erschien der Vater als Patient in meiner Praxis. Während ich bei ihm Blut abnahm, seufzte er mehrfach deutlich und in demonstrativer Lautstärke. „Na, was gibt's denn, Herr
Wegner?“, fragte ich höflich. Er sah mich vorwurfsvoll an. „Aber! Sie wissen doch! Steffen!“ Laut rief er das. Anklagend, pathetisch.
Ich merkte leider, wie das Gefühl von Ärger in mir aufstieg. Ich schaffte es irgendwie, beherrscht zu bleiben. Fast freundlich.
„Nein, Herr Wegner. Das weiß ich nicht. Zumindest nicht offiziell. Und, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Es hätte zumindest den Versuch einer Behandlung gegeben, der Ihnen und Ihrer
Gattin zu teuer war. Die Eigentumswohnungen waren wichtiger. Und ich schlage Ihnen vor, jetzt sofort meine Praxis zu verlassen.“
Abrupt stand Herr Wegner auf und verließ mit hochrotem Kopf meine Praxis. Ich habe ihn nie wieder gesehen - und das war auch gut so. Eine meiner Helferinnen kam eines Tages und berichtete,
sie habe das Ehepaar Wegner getroffen. Herr Wegner habe ihr gesagt, er sei jetzt beim Billstedter Urologen. „Der Dr. Volmer mag ja ein guter Arzt sein. Leider stimmt das Menschliche nicht
so!“, zitierte sie ihn.
Eine Woche nach Stefans Tod rief Schwester Sabine mich an. Sie habe zufällig mitbekommen, dass man in Steffens Unterlagen ein Sparbuch gefunden hatte. DM 120.000.- waren darauf ....


( Menschliche Schicksale. Wir alle haben unsere Lasten zu tragen. Das höre ich auch von den lieben Menschen, die lesen mögen, was ich aufschreibe. Oder ich weiß es, weil ich lange Jahre
mit ihnen befreundet bin. Einige meiner Freunde waren sogar mal Patienten bei mir. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich helfen konnte. Ärztliche Hilfe besteht durchaus nicht nur im
„Gesundmachen“. Wichtig ist das Zuhören. Das Verstehen. Die Zugewandtheit. Die Gewissheit für den Patienten, in wohlwollende Ohren und Herzen Sorgen abladen zu können. Auch wenn man
gelegentlich dem Patienten bestätigen muss, dass er kerngesund ist ... )
Serkan Yildirim
Serkan war der Jüngste, und einer meiner ersten Patienten gewesen. Als ich ihn kennenlernte, 1990, wegen eines Hodenhochstandes, war er gerade sieben Jahre alt geworden. Er hatte Angst.
Bildhübsch, riesige schwarze Augen in einem blassen Gesicht sahen mich furchtsam an. Was ihm gefiel, war, dass ich seine Eltern, als diese reden wollten, freundlich anwies, die Klappe zu
halten. Da kicherte er.
„Serkan ist der Patient. Jetzt ist der Junge dran.“
Ich unterhielt mich mit ihm über das Problem, das ihn zu mir geführt hatte. Ich behandelte ihn wie einen Menschen. Das imponierte ihm. Und ich besprach die möglichen Therapieformen mit
ihm. Nein, Spritzen wollte er nicht, lieber das Nasenspray. Das hätte ich übrigens auch genommen!
Wir übten gemeinsam die Anwendung mit einer Blindpackung. Er stellte sich als sehr geschickt heraus. Geschickter und verständiger, als ich es erwartet hatte. Die Eltern saßen daneben und
kamen aus dem Staunen überhaupt nicht heraus.
Danach kam er, zur Überprüfung der Wirksamkeit des Sprays und zur sonografischen Messung der Hodenvolumina, gern zu mir. Ja, und dann war alles gut. Wir vereinbarten noch zwei Kontrollen,
nach sechs und nach zwölf Monaten. Dann sahen wir uns nicht mehr.
Im Sommer 2007 stand plötzlich ein gutaussehender junger Mann in meinem Sprechzimmer. „Sag mal, kennen wir uns von irgendwoher?“
„Ich war hier mal Patient!“
In der Tat. Ich konnte mir ein „Bist Du aber groß geworden!“ nicht verkneifen. Er hatte inzwischen ein sehr gutes Abitur gemacht und studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hamburger
Universität.
„Wie kann ich Dir helfen, Serkan?“
„Du hast mir doch mal ein Nasenspray aufgeschrieben, wegen der Hoden. Ich wollte Dich fragen: Gibt es sowas auch, damit man Frauen gut findet?“
Ich verstand diese Frage zunächst tatsächlich nicht.
Serkan erklärte seine Situation. Seine Eltern hatten eine Frau für ihn gefunden, diese sei bereits aus der Türkei eingeflogen, seine und die Schwiegereltern waren sich einig, und das Mädchen
hatte zugestimmt. Er allerdings habe in sich ein lange verdrängtes Problem entdeckt. Er stand nicht auf Frauen.
„Meinst Du nicht, Serkan, dass Du das mal Deinen Eltern erzählen solltest?“
Er sah mich voll Panik an.
„Das geht nicht. Meine Mutter nimmt sich das Leben, mein Vater schlägt mich tot. In unserer Kultur ist so etwas nicht vorgesehen, weißt Du?“
Ich schlug ihm vor, das wir alle gemeinsam darüber reden. Ich kannte ja die Familie inzwischen sehr gut, und ich bildete mir ein, positiven Einfluß nehmen und das kleine Problem beheben zu
können. Blankes Entsetzen stand in seinen Augen, aus denen mich immer noch der kleine 7jährige Junge ansah. Das war völlig ausgeschlossen. Er musste heiraten, wenn die Eltern es so wollten.
Das verlangte die Tradition. Und die Kultur. Und der Hodja. Und die Verwandten. Und die Nachbarn.
Ich diskutierte mit ihm. Ich fragte ihn, ob er es denn wirklich für sinnvoll hielte, nicht sein Leben, sondern das seiner Eltern, des Hodjas, der Verwandten und der Nachbarn zu leben. Niemals
wirklich glücklich zu sein. Er entgegnete, dass niemals wirklich glücklich zu sein, nicht zwangsläufig bedeuten müsse, unglücklich zu sein.
„Du kannst mich nicht normal machen?“
„Du bist bereits normal.“
„Gesund?“
„Das bist Du schon. Du bist nicht krank.“
Eine Woche später kam er wieder, ohne Termin, aufgeregt.
„Mir ist was eingefallen! Der Hodenhochstand! Im Internet stand, dass ich vielleicht keine Kinder zeugen kann! Wenn das ihre Eltern erfahren, wird nichts aus der Hochzeit! Kannst Du mir nicht
so etwas bescheinigen? Dass ich keine Kinder machen kann?“
Es widerstrebte meiner Berufsauffassung erheblich. Aber ist man als Arzt nicht verpflichtet, zum Wohl seines Patienten beizutragen?
Machen wir's kurz: Es half nicht. Mit einem lässigen „Inschallah“ hatte sein künftiger Schwiegervater meine im Attest geäußerten Bedenken fortgewischt. Die Hochzeit wurde festgesetzt. Die
Familie lud mich ein. Ich lehnte dankend ab.
Ich sah Serkan noch einmal wieder, im Herbst 2015. Er war inzwischen Vater geworden. Und jetzt hatte er sich bei einem seiner Abenteuer in einem einschlägigen Kino in der Langen Reihe eine
ziemlich ansteckende Krankheit geholt.
Dem kleinen Jungen hatte ich die Injektionen ersparen können. Jetzt benötigte er sie. Trotz allem behielt ich das Gefühl, hier versagt zu haben. Ich frage mich, wie lange so etwas gutgehen
kann. Besonders in Serkans „Kultur“ ....


( Eins hat mir meine Praxiszeit - im Gegensatz zu der Erziehung in meinem Elternhaus - beigebracht: So gut wie keine Vorurteile zu haben. Und primär nur wenig einen Einwand gegen einen
anderen Menschen sein zu lassen. Ach, wenn meine Mutter ein Mädchen wie Monica kennengelernt hätte! Wie kann man bloß. Komm da weg, das ist kein Umgang für Dich. Alles Pack. Flittchen.
Asozial.
Oft widerhallte in meinem Kopf ihre Stimme, wenn ich meinen Patienten gegenüberstand und deren Geschichte hörte. Diese Diskrepanz! Hier das apodiktische Urteil derer, die moralisch
einwandfrei durchs Leben schreiten, dort diejenigen, die zerbrechlich sind, und angreifbar, und hilfsbedürftig. Deren Rückgrat brüchig ist. Und die man, wenn man ihnen schon nicht helfen
kann, trotzdem lieb haben, zumindest respektieren, kann. Weil sie das verdient haben ... )
Mümmelmannsberg war strukturell ein sehr junger Stadtteil. Der Anblick einer schwangeren Frau stellte somit keine Sensation dar. Auch wenn man wusste, dass die junge Frau, deren äußere Form
sich dezent verändert hatte, alleinstehend, ohne festen Partner war.
„Naaa, junge Frau? Wann ist es denn so weit?“
Monica war eine „alte“ Patientin, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Ich kam aus Richtung der U-Bahn, sie kam mir in Richtung Supermarkt entgegen. Sie sah mich unsicher an.
„Bist Du heute in der Praxis?“
„Im direkten Anmarsch zur Arbeit. Mal sehen, ob heute jemand kommt!“
„Darf ich kurz reinkommen? Ich muss Dich was fragen!“
Die Geschichte, die sie zu erzählen hatte, war so ungewöhnlich nicht. Sie wurde Mutter. Der Vater zu dem Kind war allerdings verheiratet. Kiosk-Besitzer im Kiez. Seine Gattin hatte offenbar
den gleichen Schneider wie die des türkischen Präsidenten - Kopftuch und langer Mantel. Und drei Kinder, alles Mädchen. Der Mann galt allgemein als Don Juan, der ziemlich wahllos jedes
weibliche Wesen beglückte, das darauf Wert zu legen schien. Er verfügte über mediterranen Charme, besondere anatomische Vorzüge und das Talent, diese kurzweilig einzusetzen. Und diesem
Herzensbrecher war die junge Frau erlegen.
„Ich lass es wegmachen“, erklärte sie mir unter Tränen. „Ich kann es nicht behalten!“
Ich konnte sie verstehen. Sie hatte sich mit Bienenfleiß aus ihren engen sozialen Verhältnissen herausgearbeitet, einen Abschluss als Bürokauffrau geschafft und arbeitete als solche halbtags.
Undenkbar: Alleinerziehende Mutter? Welcher Arbeitgeber würde das mitmachen? Und die Belastung für die junge Frau? Verstehen. Nicht gutheißen.
„Bist Du sicher, Monica, dass das die richtige Entscheidung ist?“
„Was würdest Du denn machen?“
Ich zögerte nicht. „Ich würde es bekommen. Keine Sekunde würde ich zögern. Wenn es etwas gibt, was meinem Leben fehlt, dann ist es ein Kind. Ich würde es bekommen. Unter allen anderen
Umständen!“
Sie sah mich überrascht an. Wir diskutierten die Situation an sich, Vor- und Nachteile des Abbruchs. „Ich bin da der falsche Ansprechpartner, Monica. Ich würde mich immer und unter allen
Umständen für das Leben entscheiden. Ich weiß, dass es manchmal die beste Lösung zu sein scheint. Aber glaube mir: Du wirst leiden. Aus hormonellen Gründen, und seelisch. Die Entscheidung
kann ich Dir nicht abnehmen. Aber egal, wie Du Dich entscheidest, bin ich für Dich da.“
Ich weiß. Ich fühlte mich auch nicht wirklich wohl bei dieser „Beratung“. Ein emanzipiertes Vollweib hätte mir vermutlich eins reingehauen und gesagt, ich soll mich nur um das kümmern, wovon
ich etwas verstehe. Ging es mich etwas an? Immerhin wurde ich um Rat gefragt. Aber man kann dann ja auch seine Inkompetenz erklären. Bin ich wirklich zuständig? Nein.
Niemand kann sich meine Freude vorstellen, als Monica ein gutes halbes Jahr später einen Kinderwagen durch meine Praxistür bugsierte. Mein Gott, war dies Kind zauberhaft! „Es sieht genau aus
wie er“, knurrte Monica. „Das ändert sich wieder“, lachte ich. „Ein Trick der Natur. Damit der Erzeuger das Kind als das Seine erkennt. Die Mutter ist ja meistens bekannt. Der Vater nicht
immer!“
Der Herr, dem Sie das Kind verdankte, führte förmlich Balztänze auf. Jeden Abend stand er vor ihrer Tür, überhäufte sie und das Kind mit Geschenken. Monicas Schilderung wies mich allerdings
darauf hin, dass er mit all dem seinen Besitzanspruch zu zementieren versuchte. „Der Rüde pinkelt in jede Ecke, um sein Revier zu markieren“, dachte ich. Die rudimentären Instinkte sind sich
doch sehr ähnlich, egal, ob es sich um einen Menschen oder einen Dackel handelt ...
Es wurde schwieriger. Der Erzeuger versuchte, Monica den Jungen wegzunehmen. Immerhin hatte er „nur“ drei Mädchen mit seiner Frau. Auf diesen Jungen war er stolz. Eine versuchte Entführung
hatte sie bereits vereitelt.
„Ist Dir klar, Monica, dass, wenn der Kerl nicht so ein widerlicher Fremdgänger, Lügner und Betrüger wäre, er vermutlich überhaupt keine Persönlichkeit hätte?“
Die Polizei konnte, wie üblich, nichts tun. Erst, wenn das Kind entführt worden wäre. Solange nichts passiert war, könne man den Herrn nicht belangen.
Monica traf die einzig richtige Entscheidung. Sie verließ die Freie und Hansestadt. Nicht ohne mir mitzuteilen, wohin. Ich verrate es auch nicht. Ich deute es nicht einmal an. Sie hatte dort
sogar Arbeit und Wohnung gefunden. Und vor allem empfand sie Glück.
Sie ist immer noch glücklich dort. Dem Kind geht es gut. Die Vergangenheit liegt weit hinter ihr. Der Kleine sagt zu jemand anderem „Papa“. In einem Anfall von Übermut habe ich sogar mal
gedacht, dass der Junge mir sein Leben verdankt. Blöd, oder? Und selbst wenn: Das ist das, was ich gelernt habe. Meine Pflicht. Kein Applaus erforderlich, für Selbstverständliches!
Meine Mutter übrigens „musste heiraten“, wie man damals, in den spießigen 50ern, sagte. Ich war unterwegs, und um anständig und ehrbar zu bleiben ...


( Ich glaube, dass ich in den vergangenen 30 Jahren mit Vertretern jeder Religion zu tun hatte. Oft musste ich mich von besonders überzeugten Patienten fragen lassen, ob ich nicht
begeistert sei, von diesem oder jenem hoffnungs- und trostspendenden Glauben. Ich, erzogen als dröger, norddeutscher Protestant, betonte regelmäßig, dass ich auch ohne religiöse Hilfe ganz
gut klarkäme und gewohnt sei, selbstständig zu denken. Woraufhin mir kistenweise Koran-Übersetzungen, Bibeln, das Buch Mormon, Publikationen einzelner Sekten und Freikirchen ins Haus
transportiert wurden, um meine Gedankenfreiheit einzuschränken.
Was wohl aus diesen Schriften geworden ist?
Erstaunlich, dass viele Menschen, sofern sie irgendwo ein weltanschauliches Vakuum wittern, bestrebt sind, dies mit ihrer eigenen, ‚einzig wahren‘ Überzeugung zu füllen, oder? Dabei
unterstelle ich liebenswürdige Absichten. Galt es doch, einen Ungläubigen, Verirrten zu erretten ... )
Reto Greifswald
Mein erster Kontakt als Arzt mit den Zeugen Jehovas fand gar nicht mit Reto statt. Ich machte vierwöchentlich Hausbesuche bei einem älteren Ehepaar. Er war mit einem Dauerkatheter versorgt,
der gewechselt werden musste. Im Dezember legte ich den Besuch dicht vor die Feiertage, damit über die lange Zeit nichts passieren konnte. Ich wunderte mich darüber, dass ich keinerlei
Dekorationen entdecken konnte; ich bin da etwas kitschig und stelle überall das kleine, gut eingepackt im Keller deponierte Sortiment an Glaskugeln, Engeln, Weihnachtsmännern und der
geschnitzten Krippe auf. „Na“, sagte ich arglos zur Hausfrau, „da haben Sie ja noch einiges zu tun, vor dem Fest! Baum noch nicht geschmückt?“
Die Antwort war dem Zischen einer Schlange ähnlich. Ärgerlich und schmallippig stieß die Dame ein erklärendes „Wir sind Zeugen Jehovas!“ hervor. Ach so. Na klar. Wie dumm von mir!
„Frohe Weih ... also, schönes Fes ... ich meine, genießen Sie die freien Tage!“
Reto war ein depressiver, angespannt wirkender Charakter. Der Schweizer Staatsbürger litt an einer chronischen Nierenbeckenentzündung, die immer wieder akut aufflackerte. Eine eher
ungewöhnliche Erkrankung für einen Mann. Immer, wenn er in der Praxis gewesen war, mussten wir hinterher die ‚Wachtürme‘ und ‚Erwachets‘, mit denen er mein Wartezimmer dekorierte, entfernen.
Auch mir drückte er meine persönlichen Exemplare in die Hand bzw. steckte sie, wenn er meinen Beistand nicht benötigte, mit einigen schriftlichen Grußworten in den Briefkasten.
Wir diskutierten viel. Was mir besonders unklar war, war die Tatsache der zahlenmäßigen Begrenzung derer, die sich nach ihrem Ableben dermaleinst im Paradies an heiter sprudelnden Bächlein
auf grünen Wiesen räkeln würden, umgeben von friedlich gesonnener Zoologie und Botanik, gelabt mit den köstlichsten Speisen und Getränken. Da gibt es nämlich nur eine fest umschriebene Zahl.
Pech, wenn man dann das kürzere Streichholz gezogen hat. Dann kommt man, statt in den Himmel für Privatpatienten, nur in die AOK-Version. Oder - und das würde ich vorziehen - die Auferstehung
fällt gleich ganz aus. Wozu auch? Für Linsensuppe mit Würstchen im Stadtpark?
Reto führte eine unglückliche, lieb- und kinderlose Ehe. Seine Gattin verweigerte sich ihm, da sie angesichts seiner Zeugungsunfähigkeit in dem verderbten, sündigen Quatsch keinen Sinn zu
erkennen vermochte. Ich wies ihn dezent darauf hin, dass wir uns in Hamburg befanden, und gerade hier fast allen Bedürfnissen ... Er starrte mich entsetzt an. Hurerei! Perversion!
Abartigkeit! Niemals!
In den Gottesdiensten, Pardon, ‚Versammlungen‘, fühlte er sich unter Druck gesetzt. Und er litt darunter, dass er zu seinem Neffen, den er sehr lieb hatte, keinen Kontakt haben durfte, da der
Sünder sich abgewandt hatte vom wahren Glauben. Denn egal, wie eng auch immer der Verwandtschaftsgrad war: Bei einer derartig schwerwiegenden Sünde wurde der Kontakt abgebrochen.
So wollen es die Ältesten.
Und Jehova.
Also, meinten die Ältesten, wenigstens.
Mit mir kam er gut aus. Er nutzte den verschwiegenen Freiraum, um sich mal so richtig auszukotzen. Sich aufzulehnen. Zu schimpfen, zu hadern - immer gefolgt von einem „Ich bitte Dich um
Vergebung, Jehova!“ Einmal antwortete ich „Sag einfach Peik zu mir, Reto!“ Das fand er aber eher weniger witzig.
Er fragte mich eines Tages, ob er sich in den Versammlungen seiner Gemeinde anstecken könnte. Dem konnte ich nicht widersprechen. Begeistert nahm er dies als Vorwand, sich dort - mit
medizinischer Absolution, gewissermaßen - nicht mehr sehen zu lassen, und die Ansprachen über einen Telefondienst zu hören.
Es war uns beiden klar, was ihm „an die Nieren ging“. Und was die Depressionen auslöste. Ausgesprochen wurde es nie. Immer, wenn ich es versuchte, entdeckte er in sich das Bedürfnis, zu
beten. Ich habe nie mehr einen schlimmeren Fall einer gespaltenen Persönlichkeit gesehen: Hier der überzeugte, tiefgläubige, missionierende Zeuge Jehovas, dort der Mann, der unter dem viel zu
engen Korsett des ‚Glaubens‘ litt und die kurzen Freiräume nutzte, um es kurz abzuwerfen und er selbst zu sein. Ein begeisterter, missionierender Gläubiger. Und jemand, der unter seinen
eigenen Regeln litt. Dem man immer wieder Rettungsringe zuwarf, um ihn vorm Ertrinken zu bewahren. Der sie ansah und sie nicht ergreifen wollte, weil ihm die Farbe nicht zusagte.
Möge seine Seele Frieden finden.


( Die paar Male, die ich mit Verbrechen oder Straftaten konfrontiert worden bin, halten sich sehr in Grenzen. Ich hatte gelegentlich Patienten aus einer nahegelegenen JVA als Patienten,
einer blieb sogar, nach seiner Entlassung, bei mir in Behandlung. Gewaltopfer habe ich häufiger gesehen. Frauen, die von Ihren Männern geschlagen wurden. Kann mir das bitte jemand erklären?
Nicht die Prügeleien. Nein.
Die Tatsache, dass die Frauen alle zu diesen Kerlen zurückkehrten, um sich nach sechs Monaten erneut mit einer geprellten Niere wieder vorzustellen. Er käme ohne sie nicht zurecht, meinte
eine Dame. Und er sei sehr lieb. Nur manchmal, da raste er eben aus. Aha. Besonders schlimm der Fall einer Vergewaltigung. Das Opfer war Zugführer beim HVV, wurde von zwei Männern überfallen,
ins Gebüsch gezerrt und missbraucht. Zur Polizei mochte er nicht gehen, aus Angst vor Spott. Dadurch war er so traumatisiert, dass er mit dem Saufen begann und inzwischen in Frührente ist.
Ja, und dann er hier ... )
Man dachte unwillkürlich an besonders kitschige Darstellungen von Engeln, wenn man dieses Kind sah. Oder an Schneewittchen. Die Stelle, wo die gute Königin sagt, hätt' ich ein Kind, so weiß
wie Schnee, so rot wie Blut, so schwarz wie Ebenholz ... nur das Luca nicht schwarzhaarig war, im Gegenteil. Sein feines, sensibles Gesicht war umgeben von einem Schwall goldblonder Locken.
Ein weicher, freundlicher Junge, der sich jedoch bisweilen auffällig verhielt und, statt zu sprechen, nur eigenartig stammelnde, unartikulierte Laute von sich gab, die ich nicht
interpretieren konnte.
„Sauerstoffmangel bei der Geburt“, erklärte die Mutter. Die Nabelschnur hatte sich ihm um den Hals gewickelt und ihn fast stranguliert. Sie allerdings könne jedes Wort verstehen. Vorgestellt
wurde mir der 5jährige Junge unter dem Verdacht auf eine Reifungsverzögerung, die ich so allerdings nicht bestätigt fand.
Einige Zeit später kam der Junge erneut, diesmal in Begleitung des Vaters. ‚Da vorne‘ wäre etwas, das Glied wäre ganz rot, eitrig und es schmerzte beim Pipi machen.
Bereits bei der Untersuchung hatte ich einen Verdacht, den ich aber umgehend fallen ließ. Ich wollte dem Kind nicht aufs Geratewohl irgendein Antibiotikum aufschreiben. Ich verordnete also
eine desinfizierende Salbe sowie Kamillebäder und bat darum, den Befund des entnommenen Abstrichs in zwei Tagen zu erfragen.
Ich hatte die Probe in ein Labor geschickt, allerdings auch selbst einen Ausstrich gemacht, den ich nun unter dem Mikroskop betrachtete. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Es handelte
sich zweifelsfrei um eine Gonorrhoe. Eine ansteckende Geschlechtskrankheit. Bitte! Der Junge war 5!
Ich rief umgehend die Ärztekammer an. Der zuständige Kollege verwies mich auf die entsprechenden Stellen im Gesundheitsamt. Ich versicherte mich, dass mein offenbarer Verstoß gegen die
Schweigepflicht keine rechtlichen Konsequenzen für mich haben würde. Der Justiziar bestätigte, dass in einem solchen Fall die Schweigepflicht das ‚nachgeordnete Rechtsgut‘ sei. Ich schilderte
den Fall und verwies auf die Untersuchungsergebnisse.
Zwei Tage später kam der Vater wegen des Rezepts. Eine Inkubationszeit von drei Tagen zugrunde gelegt, fragte ich den Mann, was Luca denn am Wochenende so gemacht hätte. Er antwortete
ausweichend. Luca wäre bei einem Freund zum Zelten gewesen. Warum ich das fragte, wollte er wissen. Ich erklärte es ihm. Er schüttelte den Kopf. Unmöglich. Ich händigte ihm das Rezept aus.
Es verging keine Stunde, da stürmte die Mutter in die Praxis und bestand darauf, mich umgehend und sofort zu sprechen. Ich erläuterte auch ihr den Befund. Ihre Reaktion bestand in einem
hartnäckigen „Das kann überhaupt nicht sein!“.
An diesem Punkt wurde mir klar, dass hier etwas nicht stimmte. Bitte, stellt Euch vor, Euer fünfjähriger (!) Sohn leidet an einer Erkrankung, die fast ausschließlich über sexuelle Betätigung
übertragen wird. Und der sich seiner Umwelt mangels Sprache nicht verständlich machen kann. Der Untersucher erzählt Euch das. Was wäre Eure Reaktion? Also, ich würde Amok laufen. Oder
schreien, vor Verzweiflung. Oder versuchen, etwas aus dem Kind oder seinem Freund herauszubekommen.
Es sei denn .... Ja. Dann würde ich auch ein beschwichtigendes „Das kann überhaupt nicht sein“ vom Stapel lassen.
In meinem Briefkasten lag ein paar Tage später ein Brief mit wüsten Beschimpfungen, was mir einfiele, unbescholtenen Menschen das Gesundheitsamt auf den Hals zu hetzen. Man würde sich
andernorts über mich beschweren. Ich würde vom Anwalt hören, man würde mir die Zulassung entziehen. Wenn ich für jedes Mal, wenn ich diesen Satz gehört habe, 5 Euro bekommen hätte, wäre ich
Millionär. Und in diesem Fall, wie in allen anderen, waren auch dies leere Drohungen.
Ich weiß nicht, wie dieser Fall ausging. Die Familie war plötzlich verschwunden, und Schweigepflicht - was den wenigsten bekannt sein dürfte - gilt auch zwischen Ärzten, so dass ich,
paradoxerweise, keine Auskünfte erhalten konnte.
Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Wenn ich zwei und zwei addiere, ergibt sich ein so unfassbar häßliches Bild, das kaum zu ertragen ist. So häßlich, dass ich sogar hoffe, mich geirrt
zu haben. Ich würde mich mit Freude beschimpfen, von mir aus wegen übler Nachrede verklagen lassen, wenn diesem Kind keine Gewalt angetan wurde.
Ich hoffe so sehr, dass es Luca gut geht.



( So. Die vorerst letzte Geschichte. Schade, werden einige denken. Gottseidank, die anderen. So verschieden ist es im menschlichen Leben, würde Tucholsky sagen. Wilma und Herbert haben zu
Frau Misowski keinerlei Bezug, außer eben den, dass beide bzw. alle drei bei mir Patienten waren. Und Frau Misowski ist auch ganz unwichtig. Aber die zentralen Begegnungen fanden am gleichen
Tag statt, wie wir gleich sehen werden, weswegen ich diese zusammenfasse und das Kapitel überschreibe: )
nebst Frau Misowski
Keiner sah ihnen ihr tatsächliches Alter an. Man hätte beide, Wilma und Herbert, auf Mitte Ende 60 geschätzt, dabei war Wilma 77, Herbert 79 Jahre alt. Herbert, wie Männer dieser Generation
nun mal waren, präsentierte sich zurückhaltend und wortkarg. Wilma allerdings berlinerte heiter vor sich hin, humorvoll, lachend, fröhlich. Bei unserer ersten Begegnung ereignete es sich,
dass es ihr, nach meiner Erklärung eines komplizierten medizinischen Sachverhalts, entfuhr:
„Herr Doktor, mit Ihnen kann man wirklich reden wie mit 'nem Idioten!“
Herbert fiel fast vom Stuhl vor Schreck.
„Wilma! Du kannst doch nicht zu Herrn Doktor ....“
„Nu' lass mich doch. Der Doktor versteht das schon ganz richtig!“
„Stimmt auffallend, Wilma, min Deern! Alles richtig angekommen!“
Wir passten wirklich gut zueinander, und es entwickelte sich ein herzliches, vertrauensvolles Verhältnis, das sich zu Fest- und Feiertagen für mich noch mit riesigen Angebinden
Niederegger-Marzipans extra auszahlte.
Ein wunderbares, beneidenswertes Paar. Ich habe so viel gelernt über Liebe, das Kämpfen, das die Hoffnungbehalten, das Niemalsaufgeben, und die bedingungslose Hingabe zweier Menschen über den
Zeitraum von fast 50 Jahren.
Die Urologie war bei beiden leicht in den Griff zu bekommen, aber die blöde rechte Hüfte ... irgendwann war Wilma auf einen Rolator angewiesen, und jeder Schritt bereitete ihr erhebliche
Schmerzen, die sie aber tapfer weglachte.
Eines April-Tages entdeckte ich, dass mein Vorrat an Bargeld sich dem Ende zuneigte, und ich beschloss, kurz zur HASPA hinüberzugehen, um mein Portemonnaie nachzufüllen. Vor der Tür stand,
rauchend, Herr Hakemann. Ein faszinierend unkomplizierter, freundlicher Typ, und der einzige Mitarbeiter dieses Kreditinstituts, den ich wirklich mochte. Unser Ritual bestand darin, dass ich
an den Schalter ging und knurrte, „Hakemann, rück die Kohle raus!“ Woraufhin er mich fragend ansah. „Kleine, nicht nummerierte Scheine?“
Ja, an dem Blödsinn haben große Jungs ihren Spaß!
Ich steuerte ihn also an, und wollte ihn gerade begrüßen, als sie sich dazwischendrängte. Wie eine Naturgewalt. Ihr stimme tönte wie die Sirene des Feuerschiffs Elbe 1. Sie redete ohne
Beachtung der Interpunktion. Sogar beim Ausatmen. Frau Minowski.
„Also Herr Hakemann sie stehen hier und rauchen und sie haben auch schon wieder zugenommen und Herr Doktor Volmer sie werden ja auch jedesmal dicker meinen Sie nicht dass man dagegen was tun
müsste das ist ja so ungesund und dann noch rauchen also ich bin ja inzwischen bei den Weight Watchers 23 kg habe ich schon abgenommen und ich fühle mich viel viel wohler wir können jetzt
schon wieder lange Spaziergänge machen und mein Blutdruck ist auch schon viel besser nicht wahr Liebling - Liebling, nun sag doch auch mal was!“
Liebling stand daneben und kam nicht zu Wort. Ich glaube, er hasste lange Spaziergänge.
Herr Hakemann und ich wurden während der Ansprache durch Beklopfen des Bauchs fachfraulich inspiziert. Und das ist etwas, was ich auf den Tod nicht leiden kann. Ich meine, wer bitte hat das
Recht, irgendjemandem auf dem Bauch herumzuklopfen? Und würdet Ihr Euch eine derartige Vertraulichkeit Eurem Bankmitarbeiter oder Arzt gegenüber herausnehmen? Na bitte.
Ich beschloss, wütend, wie ich war, zum Gegenangriff überzugehen. Ich empfahl der Dame einen Blick in den Spiegel, und wies sie auf ihre durch die Gewichtsabnahme entstandenen Furchen in
ihrem Gesicht hin. Ich wandte mich auch an Liebling und fragte ihn, ob er sich schon mit dem Putenhals seiner Gattin abgefunden hätte. Und schließlich bot ich ihr die Adresse eines
plastischen Chirurgen zwecks Bauchdeckenstraffung an.
Frau Minowski verstummte. Ihr Abgang war rasch und, freundlicherweise, nahezu geräuschlos bis auf ein wütendes „Komm, Liebling, wir gehen!“
„Die ist bestimmt nicht mehr Ihre Patientin“, grinste Hakemännchen breit.
„Das will ich aber auch hoffen“, entgegnete ich heiter.
Auf dem Rückweg in die Praxis begegnete ich meiner Freundin Wilma, die sich gerade mit ihrem Rolator zum Kiosk schleppte.
„Wilma, Wilma, so wird das aber auch nix mit unserem ‚Tanz in den Mai‘“, sagte ich zu ihr.
„Übermorgen geh ich ins Krankenhaus und bekomm 'ne neue Hüfte, dass Du es nur weißt. Nimm Dir nix vor, für den 30.!“, lachte sie.
Als Herbert eine knappe Woche später an der Rezeption meiner Praxis stand, wunderte ich mich zunächst nicht. Ja, doch. Er trug einen dunklen Anzug, Schlips und Kragen, wie man so sagt.
„Mensch Herbert“, rief ich ihm zu, „Du siehst ja so schick aus! Was hast Du denn heute noch vor?“
Wilma war gestorben. Der Eingriff war gut verlaufen, aber der Nachtwache im Krankenhaus war dummerweise entgangen, dass die frischoperierte Patientin aus dem Bett gefallen war. Erst der
Tagdienst entdeckte sie frühmorgens. Sie war bereits tot.
Für Herbert brach eine Welt zusammen. Und wie gut ich ihn verstehen konnte! Wilma war eine wunderbare Frau, und ich habe immer noch ihr Lachen im Ohr, und die kessen Sprüche.
Herbert hatte sich, um ihr das Leben schön und erträglich zu machen, aufgeopfert, und sämtliche Aufgaben übernommen, zu denen sie nicht mehr in der Lage war, immer darauf achtend, ihr nie das
Gefühl zu geben, nicht mehr Ihre Frau stehen zu können. Er litt unter der Einsamkeit. Ich merkte das daran, dass er sich immer wieder Termine geben ließ, um, im Wartezimmer von Menschen
umgeben, das Gefühl von Gesellschaft zu haben. So ging das nicht weiter.
„Herbert, in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Herbert allein sei - oder so ähnlich!“
„Seit wann glaubst Du an die Bibel?“
„Ja, manchmal steht auch was Brauchbares drin. - Glaub mir. Wenn Wilma Dich so sähe, bräche ihr das Herz. Ich bin sicher, sie hätte nichts dagegen.“
Herbert widersprach. Nein nein, er sei jetzt durch mit allem, er wartete eigentlich nur noch darauf, durch den eigenen Tod mit seiner Wilma wieder zusammenzusein, in der Ewigkeit.
„Das kann noch dauern“, warnte ich ihn. „Du bist so unfassbar gut in Schuss ... alles klappt!“
„Naja ... alles ...“ ( er zwinkerte an dieser Stelle verschwörerisch ) „ ... nun auch nicht mehr!“
„Dafür gäbe es ja Pillen!“
„Niemals!“
Meine Freude darüber, dass er vier Monate nach Wilmas Tod zu mir kam, um sich über Viagra, Levitra und Cialis informieren zu lassen, war groß. Die Nachbarin war schuld. Eine immer noch
attraktive Dame in ihren 70ern, die gesagt hatte, „es“ müsste nicht sein, aber er fand, es wäre doch vielleicht schöner, wenn „es“ von Zeit zu Zeit ... gewiss, man sei ja keine 25 mehr, aber
wenigstens gelegentlich ... immerhin wäre er noch am Leben, oder?
Ich bin sicher, Wilma war und ist sehr erleichtert. Mindestens so erleichtert wie ich.


( Wie heißt das Trinklied? „Ein könn'n wir noch, zwei woll'n wir noch, drei könn'n wir noch vertragen ... “ Na
gut!
Man muss sich ja nicht immer vertragen, nicht wahr. Das ist nun mal so. Man darf auch nicht seine Arbeitshaltung, -leistung oder
-disziplin von Befindlichkeiten oder momentanen Verstimmungen abhängig machen. Privates hat im Beruf nichts verloren. Wenn die Qualität der Arbeit leidet, ist die Professionalität am Ende.
Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps, sagte Oma immer. Aber bevor ich hier noch mehr Volksweisheiten zitiere, erzähle ich lieber die Geschichte von )
Sein kleiner Bruder, Faruq, war mein Patient Nr. 132. ( Komisch, an was man sich so erinnert! ) Der PC nummerierte die Patienten in der Reihenfolge ihrer ersten Praxisbesuche, und diese
Nummer war dann unveränderlich. Befunde wurden mit dieser Zahl versehen, was das Wiederfinden dieser sehr erleichterte.
Faruq rief mich eines Tages an. Ob ich mir mal seinen ältesten Bruder ansehen könnte. Der sei nicht krankenversichert. Er habe einen Croque-Laden gehabt, sei pleite gegangen und konnte die
Beiträge seiner privaten Kasse nicht mehr bezahlen. Er würde ihm seine AOK-Karte geben, ich könnte das ja darüber abrechnen. Das lehnte ich ab. Aber da ich inzwischen die ganze, immerhin
9-köpfige Familie kannte, bot ich an, Nr. 10 als Freundschaftsdienst zu untersuchen.
Süleyman trug eine verspiegelte Sonnenbrille und wirkte ein wenig wie einer der Blues Brothers. Obzwar der Ultraschallraum abgedunkelt war, nahm er sie auch dort nicht ab. Es ginge um den
rechten Hoden, erklärte er mir. Fühle sich komisch an. Schmerze auch gelegentlich.
Genau!
Liebe Leser, an Ihnen/Euch ist ein Urologe verloren gegangen. Glänzende Diagnose! Es handelte sich hier mit größter Wahrscheinlichkeit um einen Hodenkrebs. Und das bei jemandem, der nicht
krankenversichert ist, na Servus! Auch er kam mit der Geschichte der Karte seines Bruders. Ich erläuterte ihm, dass wir den nun aber nicht mit einer Krebsdiagnose durchs Leben laufen lassen
könnten.
Ich habe dann beim Sozialamt Billstedt angerufen. Eine der Beamtinnen dort litt freundlicherweise unter Nierensteinen, weswegen ich auf ihre tätige Mithilfe hoffen durfte. Sie hielt mit dem
zuständigen Kollegen Rücksprache und verband uns, damit dieser mir eine Vorabzusage geben konnte.
Der Labormediziner war etwas schwieriger zu überzeugen. Den Boten wegen einer dringenden Blutabnahme noch einmal schicken? Vier Tumormarker? Und das ohne gültigen Versicherungsnachweis?
Der Radiologe war ebenfalls nicht begeistert. Computertomografie der Lunge und Kernspin-Computertomografie des Bauchraums, einfach so? Na gut, mir zuliebe. Aber ungern. Höchst ungern.
Ich telefonierte noch mit der Klinik. Professor Dieckmann war und ist ein alter Freund von mir, und, was man in Berlin „eine richtige Konifere“ nennt, wenn es um Hodentumoren ging. Wir
diskutierten den Fall, und er verband mich über seine wunderbare Sekretärin, Frau Gülzow, mit dem Stationsekretär, Herrn Adam. Der Termin für die stationäre Aufnahme wurde für die kommende
Woche festgelegt, Laborwerte wurden sofort als Eilauftrag bestimmt, der Radiologe hatte die Zusage für CT und MRT in 2 bzw. 3 Tagen gegeben.
Die Telefoniererei hatte exakt 55 Minuten gedauert. Zweimal war meine Helferin nach hinten gekommen, hatte flehentlich dreingeschaut und gewispert, „Die Patienten beschweren sich schon!“ Ach,
schnick-schnack! Das war mir egal! Dem Jungen konnte geholfen werden! Alles perfekt organisiert! So wollte ich das haben!
Ich rief Süleyman zu mir, um mit ihm das weitere Vorgehen und die Termine zu besprechen. Ich gebe zu, ich hatte mir einige Reaktionen ausgemalt. Irgendetwas zwischen „Danke“ und „Ey, voll
cool, Alter!“
Mit dem, was ich hörte, hatte ich allerdings nicht gerechnet. Ob er mich ansah, konnte ich nicht sagen. Wegen der verspiegelten Sonnenbrille. Dafür sah ich mein Abbild. Ein erstauntes,
ungläubiges Gesicht, dem der Mund offen stehen blieb.
„Schneller haben Sie das nicht hingekriegt? Und Sie wollen Arzt sein? Ich geh lieber zum anderen Urologen! Vielleicht kriegt der das schneller hin!“
Sprach's, und ward nicht mehr gesehen.
Ich rief eine liebe Freundin - eher schon Vertraute - an, die im Nachbarbezirk als Frauenärztin arbeitete; Jutta Schütt. Ich brauchte dringend jemanden, bei dem ich das eben Geschehene
loswerden konnte.
„Nie wieder!“, schloss ich meine Erzählung. „Niemals mehr wieder. Künftig sage ich zu den Leuten, macht Euern Scheiß allein, und wenn Ihr die Randbedingungen geklärt habt, dürft ihr
wiederkommen!“
Zu meiner Überraschung lachte sie. „Würde Dich dass denn glücklicher machen?“, fragte sie mich. „Würde Dir das das Gefühl der Befriedigung über gute Arbeit verschaffen, mit dem wir
idealerweise nach Hause gehen dürfen?“
Sie hatte recht mit dem, was sie sagte. Gelegentlich kann ein Patient eben nicht einschätzen, wie umfangreich die Arbeit ist, die wir als Ärzte für ihn leisten. Und das sieht wie
Undankbarkeit aus.
Süleyman, so verriet mir seine Schwester, hat die Erkrankung überlebt, und es geht ihm gut.
Das ist das, was zählt.
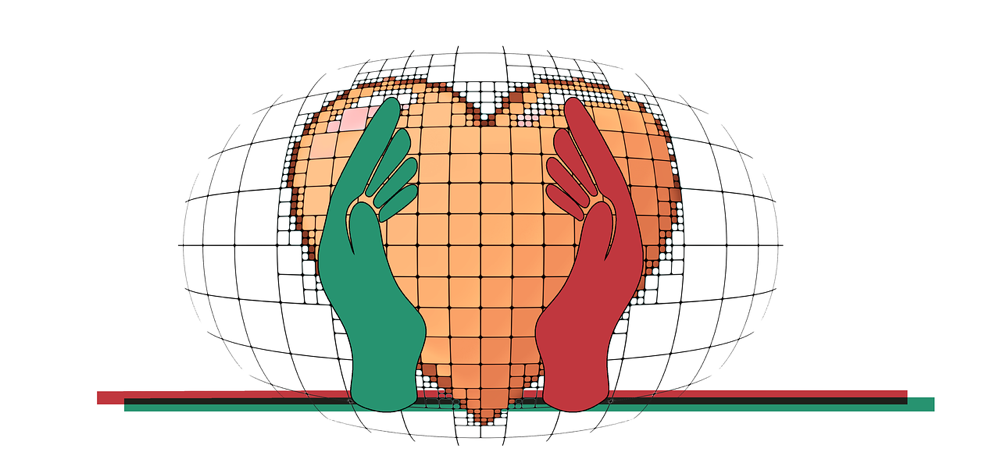


( Na gut, runden wir es noch etwas ab. Jedes Musikstück hat ja ein Schlussmotiv, eine Koda, eine Reprise. Blick zurück ohne Zorn? Ja, definitiv. Das wäre ja auch nun furchtbar, wenn nach
vierzig Arbeitsjahren sich das Leben als Irrtum herausstellte, nicht wahr. Deswegen folgt jetzt zum Schluss ... )
Das Ende vom Lied
Ich habe ja nun einige Begegnungen mit ganz besonderen Patienten aufgeschrieben. Es ist nicht so, dass die anderen, die Ungenannten, mir nicht ebenso nahestünden. Aber erzählte man die
Geschichten aller, würde es doch schnell langweilig werden, auch wenn sich immer wieder dramatische Dinge ereigneten. Zum Beispiel bei einem Ehepaar, Hans und Erna Kehr. Erna nannte ich immer
Klein-Erna, passend zur Gegend. Ich betreute sie zwei Jahre.
Wenn man sich Großeltern aus einem Katalog hätte aussuchen können, wäre die Wahl sicher auf diese beiden gefallen. Auf nichts freuten die beiden sich so sehr wie auf ihre Diamantene Hochzeit,
das Ehejubiläum nach 60 Jahren. Drei Wochen vor dem Erreichen dieses Datums erlitt er einen Schlaganfall, dem er eine Woche später erlag. Sie folgte ihrem Mann, man weiß nicht, warum
eigentlich, 10 Tage später.
Kathleen hieß eine unglaublich liebe junge Frau, die mir in breitestem Sächsisch erläuterte, „Isch arbeede in der Erodikbrangsche!“ Deswegen hatte sie oft Terminprobleme, weil sie wegen ihres
Schichtdienstes auf der Reeperbahn kurzfristig absagen musste. So richtig ans Herz wuchs sie mir, als sie mir von ihrem kleinen Sohn erzählte, für den sie immer zu Hause war, wenn er aus der
Schule kam. Sie musste ihm bei den Hausaufgaben helfen, weil er doch Legastheniker war. Und sie kochte für ihn. Am liebsten ‚Tote Oma‘. Das fand er witzig. Ich auch.
Ich denke oft an Josua Schneider. Ein 19jähriger Junge, der sich in der Praxis vorstellte, um seine Zeugungsfähigkeit prüfen zu lassen. Er leuchtete von innen heraus. Endlich war ihm seine
große Liebe begegnet, er war so voll Hoffnung und Glück.
Einen Monat später stand seine Mutter als neue Patientin vor mir. Sie sah elend aus, und hatte offenbar geweint. Ich fragte sie nach ihrem Kummer. Josua hatte sich erhängt. Seine Traumfrau
hatte es sich kurzfristig anders überlegt, und er sah keinen anderen Ausweg mehr für sich.
Ach, Jens Pawelka! Deine Frau kannte ich lange Jahre als Patientin. Eines Tages sprach sie mich auf Dich an. Ein Kollege hatte bei Dir, der Du erst 50 warst, einen hoch-aggressiven
Prostatakrebs diagnostiziert. Ob mir vielleicht noch etwas einfiele.
Fast zwei Jahre ging alles gut. Dann meldete sich das furchtbare Biest mit aller Kraft und fraß sich blitzartig durch Dich hindurch. Ich konnte kaum noch differenzieren, was im Vordergrund
stand: Die Schmerzen, die Angst, das Versagen der befallenen Organe ... es ist so furchtbar, daneben zu stehen und völlig hilflos zusehen zu müssen, wie jemand unaufhaltsam seinem Ende
entgegengeht.
Und Dich, Andreas, vergesse ich auch nie, weil ich Deinen Wandel, durch den Du zu Andrea wurdest, in jeder Phase mitbekommen habe, und Dich, die Du promovierte Akademikerin und
Sozialwissenschaftlerin warst, oft wegen der widerlichen Diskriminierungen und Anfeindungen trösten musste. Von Dir habe ich viel gelernt. Den unerschütterlichen Glauben an Dich selbst zu
behalten. Zweifel zu überwinden. Seinen Weg zu gehen.
Ich habe das große Glück gehabt, wunderbare Mitarbeiter zu haben. Es kamen und gingen auch immer wieder originelle Menschen, von denen ich mich bald trennen musste. ‚Moni‘, zum Beispiel. Kurz
nachdem sie ihre segenreiche Tätigkeit aufgenommen hatte, stiegen die Portokosten immens. Ich erkundigte mich neugierig nach der Ursache. Diese war leicht herauszufinden. Moni hatte alle
Briefe eingeschrieben verschickt, weil sie meinte, die Worte des großen Doktors verdienten einen besonders gesicherten Transport ...
Es ereignete sich eines Tages, dass ein junger Mann die Praxis betrat. Ich war gerade im Begriff, den nächsten Patienten aus dem vollen Wartezimmer abzuholen, als Moni, einen
Überweisungsschein in der Hand, mir laut von der Rezeption aus zurief, „Herr Doktor, was ist das eigentlich - Go - no - rrhoe?!“
Nie wieder ist jemand so fluchtartig aus meiner Praxis gerannt. Und Moni bat ich, künftig auch nicht mehr zu erscheinen.
Der Ersatz für sie war eine sehr adrett gekleidete, sehr schweigsame Dame, die immer frisch nach Pfefferminz duftete. Frau Warkus hielt der Belastung offenbar nicht stand. Sie kam zunehmend
unpünktlicher zum Dienst, gelegentlich gar nicht. Ich wies sie zurecht und erteilte ihr Abmahnungen. Dann, ohne vorher Bescheid zu geben, erschien sie gar nicht mehr.
Im Kühlschrank stand noch eine Flasche Fruchtsaft. Wir entschlossen uns, diese zu entsorgen. Beim Ausgießen lag plötzlich das Aroma von Wodka in der Luft ...
Eine Patientin, Frau Unterrück, hatte mich wegen einer Beschäftigung auf 400-DM-Basis angesprochen. Sie hatte bis zur Berentung im öffentlichen Dienst gearbeitet und war etwas knapp bei
Kasse. Gern stellte ich sie ein. Allerdings gab es Schwierigkeiten mit den Kollegen. Ja, Pausen standen ihr zu. Keine Frage. Aber bitte dann, wenn es den Arbeitsablauf nicht aufhielt. Und am
Montag zu, Dienst zu kommen und den Tag mit einer Pause zu beginnen ... das mochten wir alle nicht. Und Frau Unterrück möchte es nicht, dass wir das nicht mochten.
Frau Stolz war perfekt. Ein organisatorisches Genie. Fast auf die Minute genau wurden die Sprechzeiten eingehalten. Alles lief wie am Schnürchen. Ich wunderte mich zunächst nicht über
rückläufige Patientenzahlen, immerhin war Sommer, und diese Jahreszeit ist schädlich für Urologen.
Eines Tages rief mich Uwe Regenauer an, ein befreundeter Allgemeinmediziner, dessen Praxis einen U-Bahnhof weit entfernt lag, weswegen wir gern zusammenarbeiteten - und auch befreundet waren.
Er hörte sich etwas ärgerlich an. Gestern, so sagte er mir, habe er persönlich angerufen, um eine Patientin mit einer massiven Blutung notfallmäßig vorzustellen. Man habe ihm gesagt, es sei
brechend voll, und wir könnten niemanden mehr annehmen. Um 14 Uhr! Bei einem Sprechtag, der bis 18 Uhr ausgewiesen war!
Ich stellte Frau Stolz zur Rede. Das täte ihr auch leid, erklärte sie, aber ihre Kinder kämen aus der Schule, und sie müsste eben pünktlich nach Hause ...
Liebenswürdig, wie ich bin, versprach ich ihr, dass sie von jetzt ab immer pünktlich zu Hause sein würde ... Als sie ging, nahm sie das Sparschwein mit, in das die Patienten gelegentlich
einige Pfennige/Cent hineinwarfen, um ihre Anerkennung auszudrücken. Ich fragte die Mitarbeiter, ob wir dagegen etwas unternehmen sollten. Aber sie verzichteten dankend.
Frau Strahl klaute Büromaterialien und Postwertzeichen und leugnete sogar noch dreist, als ich sie auf frischer Tat ertappte. Frau Lewinski weigerte sich, ein Wischtuch in die Hand zu nehmen,
um etwas Schmutz, den die Tasche eines Patienten an der Rezeption hinterlassen hatte, zu entfernen - dafür würde sie nicht bezahlt.
Ich hatte allerdings auch hervorragende Kräfte. Herrn Engling, Frau Herrmann, Frau Vollmer und Herrn Fazel. Hohes Engagement, persönlicher Einsatz, 100%ige Zuverlässigkeit und unendliche
Geduld mit kranken Menschen und einem cholerischen Chef. Wir waren Familie. Und das schätzten die Leute.
Die einzigen, die mir in dieser Zeit immer wieder erhebliche Probleme bereiteten, waren - nein, nicht die Damen und Herren vom Finanzamt HH-Hansa. Mit denen konnte man reden. Das war manchmal
unangenehm, aber das Ergebnis immer befriedigend. Nein. Widerlich waren die Banken. Die HypoVereinsbank und die Haspa. Ich hoffe, Frau B. Und Herr S., stellvertretend für alle anderen, dass
Sie einmal in Ihren Leben erfahren, was Existenzangst bedeutet. Dass Sie einmal nachts wachliegen, weil sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und dass Sie Panik bekommen, wenn Sie den
Briefkasten freitags aufsperren, und Briefe mit schlimmen Texten und Mitteilungen über Nichteinlösung einer Lastschrift, so viele, dass man für den Versand ein DIN-A-4 - Kuvert nehmen musste.
Wie haben Sie das bloß immer hinbekommen, dass diese Briefe mich immer Freitag und Samstag erreichten? Irgendwann habe ich den Briefkasten Donnerstag zuletzt geleert, und dann wieder
montags.
Inzwischen kommt mir diese Zeit ganz unwirklich vor. Ich denke an alle und alles zurück, und ich sehe den dicken alten Mann, der sich weigerte, einen weißen Kittel zu tragen. Der hinter einer
gläsernen Schreibtischplatte saß, um deutlich zu machen, Du und ich, wir gehören zusammen. Ich verstecke mich nicht hinter Möbeln oder elektronischen Geräten. Ich bin bei Dir, wenn Du mich
brauchst. Der so laut lachte, dass seine Mitarbeiter eine schallschluckende Dämmung seiner Türen forderten. Und der sich manchmal neben Patienten setzte, sie in den Arm nahm und bitterlich
weinte.
Ich möchte keinen falschen Eindruck erwecken. Ich war nicht immer nett. Im Gegenteil. Ich konnte ziemlich biestig sein. Nach dem 7. Beschwerdebrief einer Patientin über den bösen, alten
Urologen in der Kandinskyallee schrieb mir die Ärztekammer mahnend, dass ich mein Verhalten den Patienten gegenüber dringend einer kritischen Würdigung unterziehen sollte. Ich teilte der
Kammer postwendend mit, dass das bereits geschehen sei. Ich hätte mich überprüft und festgestellt, dass ich praktisch in jeder Hinsicht perfekt sei, wie Mary Poppins.
Ich habe, trotz vieler folgender Beschwerden, nie wieder von ihnen gehört.
So, nun aber endgültig genug von den Erzählungen aus der Praxis. Ich hoffe, dass es Ihnen/Euch etwas Spaß gemacht hat. Und ich bedanke mich für das viele Feedback, das ich bekommen
habe.




